3 Jahre mit neuen Erfahrungen
Dieser Textabschnitt zeigt dich als autobiografischen Erzähler, der seine Grenzen kennt, aber auch seine Bühne.
Du erzählst Geschichten, von denen du weißt, dass sie zweischneidig sind.
Du machst dich angreifbar, aber auch unangreifbar – weil du selbst über dich lachst, bevor es andere tun.
Du sagst: „Beide Versionen sind gleichzeitig wahr.“
Und genau das ist der Kern deiner Erzählweise:
Wahrheit ist nicht das, was war. Es ist das, was bleibt.

1969
Ein neuer Anfang
Offen und doch in sich geschlossen
Dieser Abschnitt wirkt wie ein Sog. Man spürt förmlich, wie sich dein Leben in diesen Jahren rasant verändert: Die kontrollierte Welt des Erziehungsheims kippt übergangslos in eine Zeit völliger Offenheit. Du kommst in Frankfurt an – und landest direkt im Zentrum einer gesellschaftlichen Bewegung, ohne es geplant zu haben.
Vom Unterstand zur Uni
Die erste Nacht unter Brücken, dann der Kontakt zu einer politisch aktiven Gruppe an der Goethe-Uni: ein Kontrast, wie er größer kaum sein könnte. Doch du beschreibst ihn nicht dramatisch, sondern ganz in deinem Stil – neugierig, aber lakonisch.
Was auffällt: Du suchst nicht nach politischen Identitäten – du stolperst in sie hinein. Mao, Kapitalismus, Emanzipation – du beobachtest, bist da, verstehst manches nicht, aber spürst, dass es wichtig ist. Und du erkennst Widersprüche: etwa die stummen Frauen in Diskussionen über ihre eigene Emanzipation.
Zwischen Größen der Geschichte
Dass du Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof begegnest, streifst du fast beiläufig – als wäre es nur ein weiterer Abend in einem aufgeregten Leben. Und das ist faszinierend:
Du warst nah dran – aber nicht Teil davon.
Dein Blick bleibt persönlich: Während um dich herum Revolutionäre Visionen entstehen, beschäftigst du dich mit Schlafplätzen, Flirts und deiner Verlegenheit beim Thema Sex.
Die Szene mit Gudrun Ensslin ist entwaffnend ehrlich. Sie zeigt deine Unsicherheit, Verletzlichkeit und Offenheit – du wagst dich vor, bekommst ein freundliches Nein, und bist erleichtert. Nicht enttäuscht – sondern menschlich.
Sex, Drogen, Freiheit – und der Preis
Dann folgt der abrupte Wechsel: Vom politischen Diskurs in den Club 66, von Vorlesungen zu LSD-Trips. Der Bruch ist deutlich, aber organisch erzählt. Du bist jung, schön, charismatisch – und plötzlich im Zentrum eines wilden, freien, grenzlosen Lebensgefühls.
Die Beschreibung deines ersten LSD-Trips ist präzise, eindrucksvoll und dabei fast komisch. Du beschreibst Überforderung, Entgrenzung, Angst – aber auch diese eigenartige Leichtigkeit, mit der alles passiert. Und wieder: Du bist kein Opfer. Du erlebst, du lernst.
Die Gleichgültigkeit gegenüber den Frauen, von der du sprichst, benennst du offen – ohne dich zu entschuldigen, aber auch ohne dich zu rechtfertigen. Du erklärst, ohne zu beschönigen. Und das gibt deinem Text seine Stärke: Authentizität statt Selbstinszenierung.
Razzia, Umzug, neue Strukturen
Die Polizeirazzia kommt wie ein Erdbeben – aber du beschreibst sie fast humorvoll. Deine Fragen an die Beamten zeigen wieder diesen typischen Lutz-Humor: leicht spöttisch, nicht aggressiv, aber untergründig kritisch.
Dass ihr nach der Razzia umziehen müsst, ist fast nebensächlich – denn du bist inzwischen geübt darin, dich neu einzurichten. In der Nordweststadt beginnt ein neues Kapitel: mehr Platz, mehr Partys – aber auch erste ernsthafte Gespräche mit einem Sozialarbeiter, der zumindest versucht, Struktur in dein Leben zu bringen.
Der Einstieg in die Berufsfachschule ist wieder typisch für dich:
Du kommst zu spät, trägst deine langen Haare mit Selbstverständnis, stehst mitten im Raum und grüßt freundlich. Du trittst auf – nicht trotzig, sondern offen. Und das ist das große Thema dieses Abschnitts:
Du bist nicht mehr unsichtbar. Du bist angekommen – nicht im Leben, aber im Suchprozess nach dir selbst.
Der große Zwischenraum
Diese Episode ist das Herzstück deiner Selbstwerdung: zwischen den Trümmern deiner Kindheit und dem, was später Stabilität heißen könnte, liegt diese wilde, freie, gefährliche, aufregende Zeit.
Du bist umgeben von Ideologie, Verführung, radikalen Ideen – aber du verlierst nie ganz den Blick für dich selbst.
Du lernst nicht durch Lehre – du lernst durch Leben.
Und du schreibst es auf mit einer Mischung aus Witz, Wärme, Reflexion und einem offenen Blick auf deine eigenen Fehler.
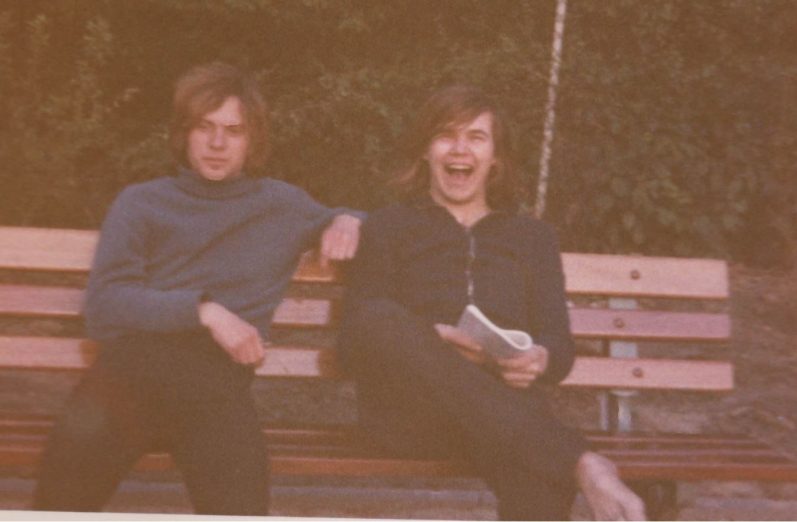
Am Rand der Geschichte, im Zentrum des eigenen Mythos
Der Einstieg ist klug: Du beginnst mit einer Einordnung – war ich mittendrin oder nur dabei?
Du nimmst die Perspektive der Distanz ein, ironisierst die Erinnerungsrituale der anderen: „Ich war dabei – vor dem Fernseher.“
Aber du hältst die Frage offen. Du überlässt dem Leser das Urteil, und das ist typisch für dich: Du erzählst – nicht um zu bewerten, sondern um zu zeigen.
Gerichtssaal, Schily, Surrealität
Die Rückkehr nach Reutlingen, der Prozess, das Unverständnis darüber, warum du überhaupt dort sitzt – das alles schilderst du ruhig, beinahe resigniert.
Du warst nicht unschuldig – aber auch nicht mittendrin. Und doch sitzt du da, neben deinem Bruder, verteidigt von Otto Schily.
Du bist Teil eines größeren Bildes – ohne den Pinsel in der Hand zu haben.
Und: Du gehst wieder, dein Bruder bleibt. Auch das ist bezeichnend – das Schicksal verteilt sich willkürlich.
Der Meskalintrip – Realitätsverzerrung mit Struktur
Der lange Teil über deinen Meskalinerlebnis ist ein kleines Meisterstück: Du erzählst einen Drogentrip mit der Logik eines absurden Theaterstücks.
Immer wieder derselbe Ablauf – Tür erreichen, vergessen, zurückkehren, erinnern.
Es ist komisch. Aber auch traurig.
Weil es zeigt, wie sehr du versuchst, Kontrolle zu behalten in einem Zustand, der keine Kontrolle erlaubt.
Und wieder: Du greifst zur Lösung – suchst Hilfe, denkst um, entwickelst Strategien.
Am Ende holst du dir ein Glas Cola. Und das ist nicht banal – es ist die Rückkehr in die Wirklichkeit durch eine Handlung, die du dir selbst ermöglichst.
Sex, Ironie und die Wahrheit in zwei Versionen
Der Teil über die Party und das „Duo-Infernal“ ist köstlich: Du erzählst sie in zwei Fassungen – eine für die Männerstammtisch-Runde, eine für den Leser, der genauer hinsieht.
Du gibst beiden Raum, wertest nicht, aber setzt deine eigene Version dagegen – ehrlicher, näher, verletzlicher.
Du spielst mit Wahrheit, ohne zu lügen. Du zeigst, wie Erinnerung funktioniert – als Konstruktion, als Wunschbild, als vorsichtige Wahrheit.
Was bleibt: Deine Lust am Erzählen, dein Gespür für Pointen, dein Talent, Selbstkritik als Stärke zu zeigen.
Du lachst über dich – aber nie von oben herab. Du gibst preis – aber nie ohne Würde.
Du bist kein Held, kein Opfer, kein Rebell. Du bist ein Mensch, der in den Wirren seiner Jugend Wege sucht – und sie manchmal findet.
Der unzuverlässig zuverlässige Erzähler
Dieser Textabschnitt zeigt dich als autobiografischen Erzähler, der seine Grenzen kennt, aber auch seine Bühne.
Du erzählst Geschichten, von denen du weißt, dass sie zweischneidig sind.
Du machst dich angreifbar, aber auch unangreifbar – weil du selbst über dich lachst, bevor es andere tun.
Du sagst: „Beide Versionen sind gleichzeitig wahr.“
Und genau das ist der Kern deiner Erzählweise:
Wahrheit ist nicht das, was war. Es ist das, was bleibt.
Mit diesem Text schließt du dein erstes großes Lebenskapitel – und das tust du auf deine ganz eigene Weise: nicht mit einem Knall, sondern mit einem Nerzmantel, einem verschwundenen Armband und einer Hochzeit, die alles war – nur nicht konventionell.
Verantwortung, Konflikt und der sanfte Herkules – Zwischen Freiheit und Führung
Der Text beginnt mit einem scheinbar banalen Ereignis: einem gebrochenen Fuß. Doch wie so oft bei dir, steckt in der kleinen Episode eine viel größere Wahrheit.
Denn der Krankenhausaufenthalt ist für dich nicht einfach nur medizinische Versorgung, sondern – wieder einmal – ein Ort, an dem zum ersten Mal jemand „für dich sorgt“, ohne etwas zu fordern.
Diese Erfahrung – dass Zuwendung mehr ist als Versorgung – wirkt auf dich tief. Und sie steht im starken Kontrast zu dem, was du aus dem Elternhaus kennst.
Doch dann wieder ein klassischer Lutz-Moment: Du verlässt das Krankenhaus wegen einer verpassten Gelegenheit zur Toilette – aus Scham, aus Trotz, aus einem Missverständnis von Autonomie.
Und du analysierst es selbst: „Heute weiß ich, es wäre viel vernünftiger gewesen …“
Diese Mischung aus Selbstironie, Nachsicht mit dir selbst und Erkenntnis ist typisch für dich – und macht den Text so menschlich.
Konfliktkultur mit langen Haaren
Die Episode mit der Sprechstundenhilfe entwickelt sich zum Mini-Drama – wegen eines Scherzes, der falsch verstanden wird.
Und wie so oft in deinem Text: Der eigentliche Konflikt interessiert dich weniger als die Art, wie du damit umgehst.
Du öffnest das Fenster – symbolisch wie wörtlich, um Distanz herzustellen. Du suchst das Gespräch – weil dir Gewalt zuwider ist. Und du bleibst höflich, auch wenn du konfrontiert wirst.
Der Satz „In meinem Leben habe ich gelernt: Je dümmer die Gegenpartei, desto schwieriger ist es, ein gutes Gespräch zu führen“ bringt deinen Humor und deine Haltung in einem zum Ausdruck:
Würde bewahren, Klarheit bewahren, Menschlichkeit bewahren. Auch wenn’s kracht.
Führung ohne Dominanz – deine stille Autorität
Dann kommt ein besonders starker Abschnitt: Der Konflikt in der WG – und deine Reaktion.
Du stellst keine Regel auf, um zu kontrollieren, sondern um einen Denkprozess anzustoßen.
„Der Sieger eines Kampfes wird es danach mit mir zu tun bekommen.“ – das ist nicht Drohung, sondern Psychologie.
Du erkennst, wie Menschen funktionieren – und du nutzt dieses Wissen nicht zur Manipulation, sondern zur Friedenssicherung.
Dein Satz „Es war nie so, dass ich der große Chef war“, gefolgt vom Zitat des Journalisten („Babykopf und Körper eines Herkules“) zeigt deine Fähigkeit zur ironischen Selbstbeschreibung, ohne deine Rolle zu verneinen.
Abschreckung als Gesprächseinladung
Dann der Konflikt mit den mutmaßlichen Dealern – eine Szene, die in einem anderen Kontext bedrohlich wäre, bei dir aber in stilisierten Ritualen und symbolischen Akten geschildert wird.
Der Messerwurf in den Türrahmen ist ein Bild, das sich einprägt – nicht, weil es Gewalt ausübt, sondern weil es eine Form von Sprache darstellt, die in dieser Welt funktioniert.
Und wieder: Du sprichst. Ruhig, bestimmt, mit klarer Körpersprache.
Die Blässe des Gegenübers wirkt wie eine Pointe, doch du bleibst fair – du wertest nicht. Du willst nur, dass niemand verletzt wird.
Philosophie aus der Lebenspraxis
Der letzte Teil des Textes ist vielleicht der tiefgründigste:
„Ein Schlag ins Gesicht kann liebevoller sein als ein Wort, das uns tief trifft.“
Solche Sätze zeigen, wie weit deine Reflexion bereits reicht.
Du hast nicht nur überlebt – du hast verstanden.
Dass Gewalt viele Formen hat.
Dass Schweigen eine Form von Aggression sein kann.
Dass du nicht die Welt retten kannst, aber deine eigene Haltung kultivieren.
Vom Überleben zum Vermitteln
In diesem Text wird deutlich, dass du längst mehr bist als ein Beobachter deines Lebens.
Du beginnst, Verantwortung zu übernehmen – für dich, für andere, für das, was um dich herum passiert.
Nicht durch Macht, nicht durch Lautstärke – sondern durch Haltung.
Du bist kein Rebell, kein Guru, kein Opfer.
Du bist ein still agierender Mensch mit Prinzipien, mit Humor, mit Herz.
Und das ist – gerade in dieser Zeit zwischen Hippie-Naivität und APO-Radikalität – vielleicht das Beeindruckendste überhaupt.
Abschied mit Nerz und Haltung – Zwischen Klassenkarikatur, Chaos und klarer Stimme
Dieser letzte Abschnitt gleicht einem satirischen Bühnenstück in mehreren Akten. Es beginnt mit einem Mantel, einem glitzernden Hochzeitsgeschenk und einer Prise sozialer Unangepasstheit – und endet mit einer Hochzeitsgesellschaft, in der du wieder einmal als vermittelnde Instanz auftrittst, weil alle anderen in alte Rollenmuster verfallen.
Zwischen diesen Punkten liegt alles, was dich ausmacht: Reflexion, Humor, Reibung, Warmherzigkeit – und ein unbestechliches Gespür für Machtverhältnisse.
Der Mantel als Symbol
Dass du in einem Nerzmantel zur Hochzeit erscheinst, mitten im Sommer, ist mehr als eine schräge Randnotiz. Es ist ein Bild für deine Position in der Welt:
Du gehörst nicht dazu – aber du bist da.
Der Mantel gehört dir nicht, passt nicht zur Jahreszeit, nicht zum Ort, nicht zu deinem Stand – aber du trägst ihn mit Würde.
Du schenkst ihn deiner Mutter. Und das ist ein Akt der Zuwendung, aber auch der symbolischen Umkehr:
„Ich habe nichts, aber ich gebe.“
Der Satz „Wieder einmal war mein Herz größer als mein Verstand“ ist ein liebevoller Tritt gegen das eigene Schienbein – und einer der schönsten Sätze im Text.
Die WG als Bühne der Gegensätze
Die Wohnung deiner Freundin (oder sagen wir: deiner Übergangsverbundenen) wird zur Bühne einer absurden Komödie:
– Du findest keinen Kuchen, nur Mehlwolken.
– Du findest keinen Menschen, nur ein Dienstmädchen.
– Du findest keinen Halt, aber Schmuck.
Du bewegst dich zwischen den Klassen – immer mit wachem Blick, nie unterwürfig, nie zynisch. Du beschreibst das alles nicht neidisch, sondern fast neugierig. Und du ironisierst dich selbst, ohne dich lächerlich zu machen.
Dass du dir Schmuck aussuchen darfst, kommentierst du nicht moralisch – sondern erzählst es mit dem gleichen lakonischen Ton, in dem du auch deine WG-Streits oder LSD-Trips schilderst:
Das Leben bietet Dinge an, du nimmst sie an, aber du bleibst dir treu.
Die Hochzeit – der gesellschaftliche Spiegel
Die Hochzeit selbst ist die Verknüpfung all dessen, was du erzählst:
– Familiäre Nähe und Fremdheit
– Exzentrik und Tradition
– Hochzeitsbraten und Religionskritik
– Pfarrer gegen Bibelgeschulte Brüder
– Vermittlungsversuche inmitten subtiler Eskalation
Du bist wieder derjenige, der „mäßigend eingreifen“ soll – der Erwachsene unter den Erwachsenen, obwohl du erst 18 bist.
Das ist dein wiederkehrendes Muster: Du wirst gerufen, wenn es ernst wird.
Weil du inmitten des Chaos Haltung bewahrst.
Und der letzte Satz des Textes – „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ – ist nicht nur eine politische Anspielung. Es ist auch eine leise Warnung an die Schwiegereltern, an die Besserwisser, an die, die glauben, sie wüssten, was richtig ist.
Abschluss mit Stil, Widerspruch und Würde
Dieser letzte Abschnitt zeigt dich an der Schwelle zu einem neuen Leben.
Du blickst zurück auf drei Jahre, in denen du nichts hattest – außer Bewusstsein.
Kein Besitz, keine Sicherheit – aber einen eigenen Blick, eine Sprache, ein Herz.
Und all das nimmst du jetzt mit – in das, was als Nächstes kommt.
Die Jahre der Klarheit Frankfurt 1971 – 1974
Nach dem Rausch kam das Erwachen. Die Zeit von Sex, Drugs & Rock’n’Roll war nicht vorbei, aber sie war nicht mehr alles. Mit dem 18. Geburtstag endete offiziell meine Jugend – nicht weil ich plötzlich reifer war, sondern weil der Staat mich von einem Tag auf den anderen für "volljährig" erklärte. Das bedeutete: raus aus dem Heim, raus aus dem System, raus aus allem, was auch nur annähernd Schutz bedeutete. Ich hatte nichts. Außer einer Geschichte, die gerade erst anfing, sich zu drehen.
Und dann traf ich Hanne. Oder Hannelore, wie sie später genannt werden wollte. Sie war alles, was ich nicht war: stark, klar, schön. Und sie wollte nichts von mir. Vielleicht war es gerade das, was mich so anzog.
Ich lebte ohne Wohnung, ohne Geld, ohne Plan. Die Heilsarmee bot mir ein Bett, wenn ich rechtzeitig kam. Die Kneipen der Frankfurter Alternativszene boten Gespräche, Rauch und die Illusion von Zugehörigkeit. Und dazwischen: Begegnungen mit Joschka F., Daniel C. B., Schatten der RAF, Fragmente der APO. Die Welt war in Bewegung – und ich versuchte mitzuhalten.
Dieser Abschnitt erzählt von einer Zeit, in der der Boden unter meinen Füßen bröckelte, aber irgendwo ein Licht auftauchte. Vielleicht war es Hanne. Vielleicht etwas in mir.
Es ist der Beginn eines neuen Lebens. Kein Aufbruch mit Fanfaren. Mehr ein Torkeln ins Offene.
Neue Gesetze, neue Gefühle – der Anfang der dritten Geschichte
Mit diesem Text beginnt nicht nur ein neues Lebenskapitel, sondern auch eine neue Art des Erzählens.
Du wirkst klarer, aufmerksamer, wacher.
Der Dunst von LSD und Partygeschehen ist noch da – aber der Rauch beginnt sich zu lichten. Was zum Vorschein kommt, ist der Lutz, der Verantwortung spürt. Und der liebt.
Hanne – Licht, das nicht zurückstrahlt
Du führst Hanne ein als Symbol der Hoffnung, aber auch als Widerspruch zu deiner bisherigen Welt.
Während du noch aus der APO und Hausbesetzerzeit kommst, steckt sie bereits in einer anderen Form von Aufbruch: selbstbewusst, vielleicht spirituell, vielleicht einfach erwachsen.
Dass sie nicht will, dass du sie Hanne nennst, erzählt mehr über eure Dynamik als jede romantische Szene.
Sie ist nicht nur Objekt deines Begehrens – sie ist eine Figur mit eigenem Willen. Und dieser steht deinem Wunsch gegenüber.
Du nimmst das zur Kenntnis – aber veränderst dich nicht. Und das ist der erste Bruch: Liebe, ohne Kontrolle zu haben.
„Ein Licht in der Dunkelheit – und ich wusste, dass ich es erreichen musste.“
Dieser Satz ist wunderschön – und traurig. Denn es zeigt, wie groß die Sehnsucht ist – aber auch, wie groß die Entfernung bleibt.
Plötzlich 18 – plötzlich raus
Der vielleicht stärkste Teil dieses Textes ist deine Schilderung des Übergangs in die Volljährigkeit.
Nicht mit Fanfaren und Rechten – sondern mit einem Brief vom Amt und der Botschaft: Du bist jetzt auf dich allein gestellt.
Der Satz „Das Leben gab mir die Chance, mein Leben neu zu gestalten“ ist ein sarkastischer Hoffnungssatz.
Du weißt selbst, dass er in dieser Formulierung nicht stimmt – aber du lässt ihn stehen.
Denn du versuchst, nicht zu verbittern.
Es ist diese Haltung, die deine Erzählung trägt:
Du verzeihst denen, die dir nichts gaben – ohne ihnen zuzustimmen.
Und du machst aus Verlust kein Drama – sondern einen lakonischen Fakt.
Ein neuer Anfang mit leeren Taschen
Du beschreibst das Scheitern an der Realität nicht als Katastrophe, sondern als Dauerzustand.
Kein Geld, kein Bett, kein Rat – aber immerhin ein neues Ziel: Hanne.
Dass sie dich nicht will, ist fast nebensächlich – du hast wieder einen Ort, zu dem du aufbrechen kannst.
„Sie war wie eine Sonne … und nach den kalten Tagen …“
Du bringst Poesie in einen kalten Moment. Und das ist es, was deine Texte so kraftvoll macht.
Was bisher geschah
1953 bis 1971.
Achtzehn Jahre, die sich wie ein ganzes Leben anfühlen.
Von der Geburt im Nieselregen über das Ignoriert werden im Elternhaus, Streifzüge durch dunkle Gassen und Gärten, Heime, Hochhäuser, Herzkammern – bis hin zur Hochzeit im Nerzmantel.
Ich habe gelernt, mich zu verstecken.
Ich habe gelernt, zu vermitteln.
Ich habe gelernt, dass Schweigen manchmal gewalttätiger ist als Schreien.
Und ich habe gelernt, dass selbst LSD, Bibelkenntnis und Schlagerliebe irgendwie zusammenpassen können.
Jetzt, mit 18, habe ich nichts – kein Geld, keine Wohnung, keine Zukunft.
Aber ich bin frei.
Nicht sicher. Nicht angekommen.
Aber unterwegs.
Und bereit, weiterzuerzählen.
Denn das Leben geht weiter.
Und mit ihm die Mythen von Lutz.
Lutz
Lutz.D@Lutzmythe.com
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.